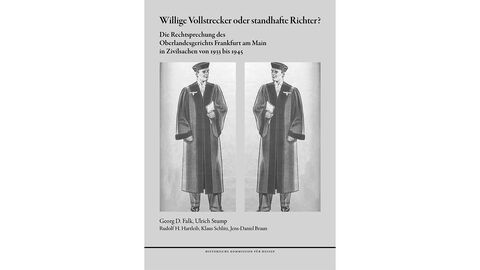Sie galt im NS-Staat als „halbjüdischer Mischling“, denn nach ihrer Geburt im Jahr 1913 hatte ihre damals unverheiratete 20-jährige Mutter einen jüdischen Kaufmann als Erzeuger angegeben
Die nächsten 20 Jahre spielte das für die heranwachsende Frieda keine Rolle. Ihre Mutter hatte inzwischen den Mann ihres Lebens gefunden, einen wohlhabenden Frankfurter, der Frieda auch seinen Familiennamen gab und in den folgenden 11 Jahren ein Luxusleben ermöglichte; sie erhielt Klavierunterricht, besuchte ein Pensionat in der Schweiz und ließ sich später zur Sängerin ausbilden.
Ausgerechnet bei ihrem ersten Engagement in Regensburg wurde ihr die längst vergessene eidliche Erklärung ihrer Mutter, sie habe Ende des Jahres 1912 nur mit dem jüdischen Kaufmann Geschlechtsverkehr gehabt, zum Verhängnis. Sie wurde als „Jüdin“ diffamiert, und ihre Anstellung als Opernsängerin endete abrupt. Angesichts dieser diskriminierenden Lebensumstände wollte Frau Winhold deshalb jetzt gerichtlich festgestellt haben, dass ein „arischer“ Schlosser aus Frankfurt ihr wirklicher Vater war; den benannte ihre Mutter – 25 Jahre nach Friedas Geburt – plötzlich als weiteren Geschlechtspartner.
Die Klage blieb auch im Berufungsverfahren beim OLG erfolglos, weil sich der notwendige Beweis seiner Vaterschaft nicht mehr führen ließ. Der bislang als Vater geltende jüdische Kaufmann konnte infolge seiner Deportation nicht mehr als Zeuge vernommen werden und die eingeholten Gutachten hatten keinen der beiden Männer als Erzeuger ausgeschlossen.
Ein juristisch unauffälliges Urteil, das dennoch ein bedrückendes Dokument der Zeit darstellt. Vier Wochen nach dem Urteil starb Frieda Winhold; es spricht einiges dafür, dass sie sich wegen der rassistischen Verfolgung das Leben genommen hat.
In einigen Fällen schufen die Richter des Oberlandesgerichts aber auch Unrecht auf herkömmlichen „alten“ gesetzlichen Grundlagen. An einem rechtlich völlig unvertretbaren Urteil wird besonders deutlich, wie damals die Rechtsdogmatik willkürlich im Sinne der rassistischen Staatsideologie instrumentalisiert wurde.
Ein Unrechtsurteil: Darlehensrückzahlung an die jüdische Lebensgefährtin?
Alice Biow, die jüdische Bürovorsteherin eines prominenten Frankfurter Rechtsanwalts, wurde am 11. Juni 1942 aus Frankfurt nach Sobibor verschleppt und dort am 1. Juli ermordet. Sie hatte seit 1923 eine eheähnliche Beziehung zu einem Zahnarzt unterhalten. 1935 nach Inkrafttreten des „Blutschutzgesetzes“ wurde das Paar denunziert. Der Zahnarzt kam erst frei, als Frau Biow eidlich bekundete, nach Inkrafttreten des Gesetzes habe zwischen ihnen kein Geschlechtsverkehr mehr stattgefunden. Wenig später erfolgte anonym eine erneute Denunziation; als der Zahnarzt deshalb zur Gestapo vorgeladen wurde, nahm er sich das Leben. Alice Biow verklagte die Erben ihres Lebensgefährten auf Rückzahlung ihm gewährter Darlehen. Die Erben verweigerten die Zahlung und beriefen sich auf eine Nichtigkeit der Darlehensverträge nach § 138 BGB wegen Sittenwidrigkeit.
Nach traditioneller Dogmatik kann aber ein Darlehensvertrag nach seinem objektiven Inhalt keinen Sittenverstoß darstellen. Eine Nichtigkeit nach § 138 BGB kommt nur dann in Betracht, wenn der grundsätzlich erlaubte Geschäftsinhalt mit einem unsittlichen Beweggrund und Zweck derart eng verbunden ist, dass sich der Darlehensvertrag nach seinem Gesamtcharakter als sittenwidrig darstellt. Das versuchte das Oberlandesgericht 1938 mit einer völlig abwegigen Argumentation zu begründen und verneinte die Entstehung einer Darlehensforderung.
„Von 1923 bis zur Kenntnis von dem Erlass der Nürnberger Gesetze hat zwischen der Klägerin und dem verstorbenen Dr. B. ein mit Geschlechtsverkehr verbundenes und auf die Dauer berechnetes Verhältnis bestanden […]. Dieses dem außerehelichen Geschlechtsverkehr dienende Verhältnis stand von Anbeginn an im Widerspruch zu den allgemein gültigen Sittengesetzen, auch wenn das Verhältnis […] nicht zugleich ein ehebrecherisches war. […] Das Aufrechterhalten derartiger enger Beziehungen zwischen einem Angehörigen deutschen oder artverwandten Blutes und einer Jüdin, wie sie zwischen der Klägerin und dem Erblasser bestanden hatten, widerspricht der heute in der nationalsozialistischen Weltanschauung begründeten Sittenauffassung des Deutschen Volkes auch dann, wenn ein nach den Nürnberger Gesetzen jetzt strafbarer Geschlechtsverkehr nicht mehr stattgefunden hat.“
Das Gegenstück zu solchen als Unrecht zu qualifizierenden Entscheidungen bildet eine etwa gleich große Gruppe solcher Entscheidungen, die sich als mutig würdigen lassen. Mut war in jedem Fall verlangt, wenn auf einer Seite des Rechtsstreits – unmittelbar oder mittelbar – „der“ Staat, die NSDAP oder eine ihre Organisationen stand, oder wenn rassistisch Verfolgte oder politisch Diskriminierte um ihr Recht kämpften.
Als Instrument der Rechtsanwendung nutzen die Richter dabei regelmäßig die klassische juristische Methodenlehre sowie die bis 1933 grundsätzlich anerkannte zivilrechtliche Dogmatik, auf die sie sich häufig auch ausdrücklich beriefen, etwa bei der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards im Prozessrecht oder beim Festhalten an vertraglichen Bindungen im Vertrags- und Wirtschaftsrecht oder bei der Absage an die von der NS-Rechtstheorie verlangten „Auflockerung“ überkommener prozessrechtlicher Regeln.
Derart mutiges Verhalten wirkte sich bei Beteiligung diskriminierter Parteien im Einzelfall unrechtsabwehrend aus. Einige dieser Entscheidungen wird man auch verstehen können als Beispiele für einen „defensiven Widerstand“ von Richtern gegen ein als Unrecht erkanntes System. Rechtsprechungsergebnisse, in denen den Opfern des NS-Staates Gerechtigkeit widerfuhr, kritisierten die NS-Rechtsideologen als Ergebnis „abstrakt-normativistischen Denkens“ und „Ausdruck einer Hilflosigkeit, Entwurzelung und Verweichlichung“.
Eine mutige Entscheidung: Eine Siedlerstelle für einen politischen Gegner?
1932 hatte eine städtische Wohnungsbaugesellschaft dem Erwerbslosen Ernst Mulansky eine Siedlerstelle in einer neu zu errichtenden vorstädtischen Siedlung vertraglich zugesichert. Mulansky war bis 1933 Mitglied der SPD und des „Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold“, außerdem war er der Sohn des prominenten gleichnamigen Gewerkschaftsführers. Die Wohnungsbaugesellschaft verweigerte ihm nunmehr – unterstützt durch die NSDAP und die Stadtverwaltung – die Zuweisung einer Siedlerstelle. Wegen seiner politischen Vergangenheit sei er in der Gemeinschaft der Siedler „ungeeignet“. Das wies das Oberlandesgericht mit klaren Worten zurück.
„Die Mitgliedschaft bei dem Reichsbanner und der SPD konnte bis März 1933 nicht dem Willen der Staatsführung widersprechen. Bis dahin bestanden die SPD und das Reichsbanner zu Recht. Eine Betätigung für sie war nicht verboten und unter Strafe gestellt. [...] Die Tatsache, daß der Vater des Klägers Gewerkschaftssekretär war, kann keine Berücksichtigung finden. Es liegt außerhalb jeglichen Tätigwerdens des Klägers.“
Gesamtergebnis Zivilrechtsprechung des Oberlandesgerichts 1933 bis 1945
Das Gesamtergebnis der Untersuchung zur Zivilrechtsprechung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Anders als nach 1945 zugunsten der Ziviljustiz apologetisch behauptet, zeichnete sich auch die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der NS-Zeit keineswegs durch einen „starken Unabhängigkeitssinn“ aus. Die Ziviljustiz präsentierte sich im Prinzip so, wie man sie auch vor 1933 kannte. Zum Schwur kam es ohnehin nur bei einem kleinen Bruchteil der Entscheidungen. In der großen Mehrheit der Entscheidungen überwog eine „Normalität“ im „Unnormalen“. Angesichts der Rahmenbedingungen gab es selbst bei „richtiger“ Rechtsanwendung keine Inseln NS-freier Normalität.
Eine solche Rechtsprechung trug bei den rechtsuchenden Deutschen letztlich auch zur Wirkungsmacht des Nationalsozialismus bei. Gerade im Ehescheidungsrecht, das einen Großteil der Urteile ausmacht, wird Bedeutung und Wichtigkeit einer Rechtsprechung deutlich, die sich mit den alltäglichen Existenzproblemen der Menschen beschäftigt, und dabei auch nicht-ideologiegeprägte Erwartungen erfüllt. Auf diese Weise stabilisierte die Justiz den Staat und die NS-Herrschaft.